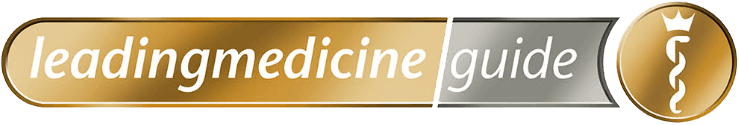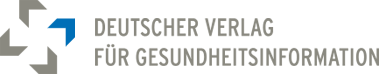Hier finden Sie alle wichtigen Informationen sowie qualifizierte Spezialisten für Autoimmunerkrankungen.
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen sowie qualifizierte Spezialisten für Autoimmunerkrankungen.
Artikelübersicht
- Diabetes Typ I
- Multiple Sklerose
- Morbus Crohn
- rheumatisches Fieber
- Zöliakie (Glutenunverträglichkeit)
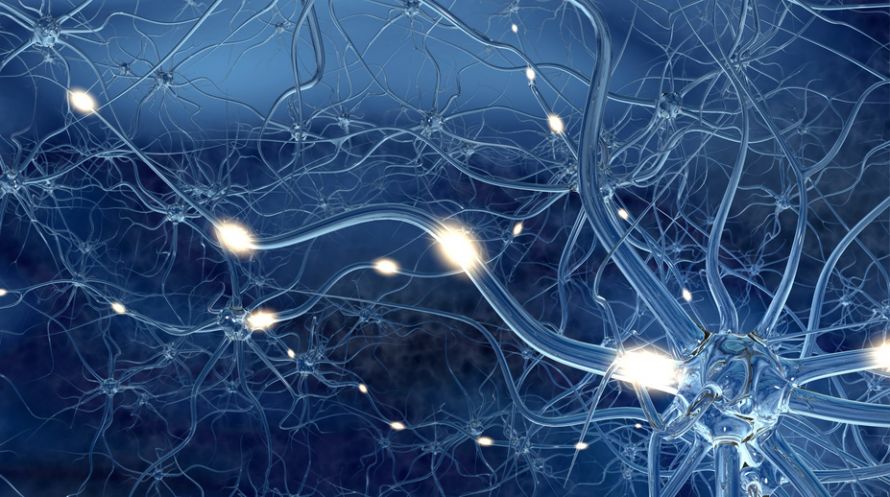
© Sagittaria / Fotolia
Ursachen von Autoimmunerkrankungen
Warum Abwehrzellen in bestimmten Fällen körpereigenes Gewebe angreifen, statt Krankheitserreger abzuwehren, ist noch nicht zur Gänze geklärt. Manche Autoimmunerkrankungen werden durch Antikörper aus allergischen Kreuzreaktionen ausgelöst. Dabei ähneln Antigene von Viren oder Bakterien körpereigenen Strukturen sehr stark. Das Immunsystem ist dann nicht in der Lage, die fremden Strukturen korrekt zu identifizieren.
In vielen Fällen lassen sich sogenannte Autoantikörper nachweisen: Das sind vom Immunsystem gebildete Abwehrzellen, die sich gegen ganz bestimmte Zellen oder Gewebe des eigenen Körpers richten und in der Folge eine Autoimmunerkrankung auslösen.
Welche Symptome sind typisch für Autoimmunerkrankungen?
Die fehlgeleitete Immunreaktion führt zu Entzündungen und kann jedes Organ treffen. Richtet der Körper beispielsweise seine Abwehrzellen gegen das Nervensystem, entwickelt der Betroffene zum Beispiel eine Multiple Sklerose. Morbus Basedow dagegen entsteht, wenn der Körper das Drüsensystem ins Visier nimmt. Autoimmunerkrankungen äußeren sich meist durch unspezifische Symptome:- Bauchschmerzen
- Mundtrockenheit
- Fieber
- Durchfall
- Muskelschmerzen
- Nierenschmerzen
Die Krankheitsursache: Risikofaktoren-Modell
Warum das Immunsystem körpereigene Systeme angreift, kann die Medizin bisher nicht genau erklären. Die Forschungsergebnisse legen jedoch nahe, dass erst eine Kombination verschiedener Ursachen die Autoimmunerkrankung auslöst. Zu den Risikofaktoren zählen:- Fehlprogrammierungen während besonderer Situationen (wie bei Infekten oder Schwangerschaft)
- genetische Faktoren
- Umweltfaktoren, zum Beispiel Stress oder Schadstoffe
- Toleranzverlust des Immunsystems
Möglicherweise entstehen Fehlprogrammierungen des Immunsystems durch Infekte, Medikamente oder auch während der Schwangerschaft. Dringt ein Virus in den Körper ein, bildet das Immunsystem sogenannte Antigene, die den Eindringling bekämpfen. Weist der Virus ähnliche Strukturen wie ein körpereigenes Gewebe auf, können die Antigene auch dieses Gewebe angreifen.
Das renommierte Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlichte außerdem eine internationale Studie über die Bedeutung der Gene. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Veranlagung für eine Autoimmunerkrankung innerhalb einer Familie vererbt wird. Die Krankheit selbst geben die Eltern aber nicht direkt an ihren Nachwuchs weiter.
Umweltfaktoren wie Schadstoffe oder stresshafte Lebensumstände beeinflussen die Schwere der Erkrankung und fördern oder hemmen ihre Entstehung. Die Hygienehypothese beispielsweise geht davon aus, dass übertriebene Hygiene während der Kindheit schadet. Sie hemmt die Entwicklung eines gesunden Immunsystems. Ein weiterer auslösender Faktor ist der Toleranzverlust des Immunsystems. Damit meint die Medizin die Fähigkeit des Körpers, eigenes Gewebe von Fremdem zu unterscheiden. Verliert das Immunsystem diese Fertigkeit, wird der Körper das Opfer seiner Immunreaktion.
Therapiemöglichkeiten
Nach der Diagnose wird der Arzt die Therapie mit seinem Patienten besprechen. Im Fall einer Autoimmunerkrankung gibt es mehrere Optionen:- Medikamente, die auf das Immunsystem wirken
- Stammzellentherapie
- Psychotherapie
- Ergo- und Physiotherapie
- Ernährungsberatung
Ein zentraler Pfeiler der Behandlung sind Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken. Diese Immunsupression bringt Schwierigkeiten mit sich: Neben dem Schutz der betroffenen Organe verhindert die Medikation, dass sich der Körper vor Infektionen schützen kann. Die Ärzte stimmen die Dosis daher sehr exakt auf den Einzelfall ab. Die Stammzellentherapie ist eine ethisch umstrittene Möglichkeit zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten. Stammzellen verfügen über eine Besonderheit: Sie haben keine feste Funktion, wie etwa Hautzellen oder Nervenzellen. Welche Zellenart aus ihnen entsteht, hängt von der Umgebung ab, in der sie sich entwickeln.
Psychotherapeutische Begleitung ist zudem ratsam, um dem Betroffenen den Umgang mit der Diagnose zu erleichtern. Ansonsten besteht die Gefahr einer psychischen Erkrankung, wie etwa einer Anpassungsstörung oder einer Depression. Nach einem Krankheitsschub können spezielle Ergo- und Physiotherapien helfen, körperliche Fitness und motorische Fähigkeiten zu verbessern. Bei einigen Autoimmunerkrankungen wie etwa Zöliakie oder Diabetes ist darüber hinaus eine Diät wichtiger Teil der Therapie. Die Ernährungsberatung unterstützt die Patienten, einen ausgewogenen und auf sie zugeschnittenen Essensplan zu erstellen.
Leben mit der Krankheit: Heilung und Prognose
Autoimmunerkrankungen kann die Medizin bisher nicht heilen. Es stehen jedoch zahlreiche, sehr wirksame Mittel zur Verfügung, die den Krankheitsverlauf günstig beeinflussen und die Beschwerden lindern. Je nach Diagnose, Schweregrad und persönlichen Merkmalen verläuft die Krankheit von Fall zu Fall unterschiedlich. Krankheiten wie die Multiple Sklerose treten schubweise auf. Die Folgen eines Schubes bilden sich anschließend entweder vollständig zurück (Vollremission) oder es bleiben Restbeschwerden erhalten (Teilremission).
Im Verlauf der Krankheit kann es passieren, dass der Arzt eine weitere Diagnose stellt. So tritt zum Beispiel ein Diabetes häufig zusammen mit einer Zöliakie auf. Diese Art von Krankheit verändert das Leben des Patienten und das seines Umfeldes. Sie sind damit aber nicht allein. Ein interdisziplinäres Team begleitet die Therapie und hilft, die körperlichen und psychischen Folgen zu bewältigen. Darüber hinaus unterstützen regionale Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen die Betroffenen, ein lebenswertes Leben zu gestalten.
Quellen
- https://www.autoimmun.org/erkrankungen
- https://flexikon.doccheck.com/de/Autoimmunerkrankung
- https://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/home.html
- https://www.dmsg.de/
- Stangel M, Mäurer M (Hg.): Autoimmunerkrankungen in der Neurologie: Diagnostik und Therapie. Springer Berlin Heidelberg 2018
- Ferencik M, Rovensky et al.: Kompendium der Immunologie: Grundlagen und Klinik. Springer Wien 2006